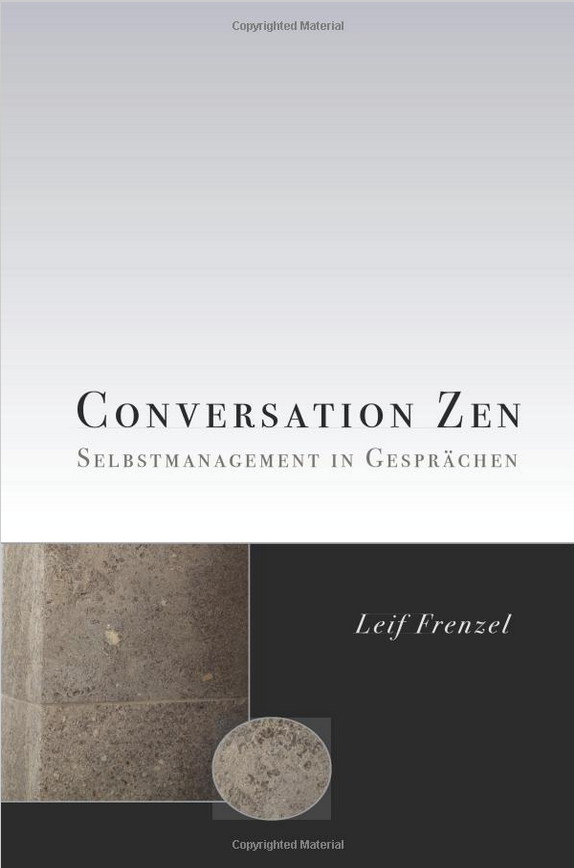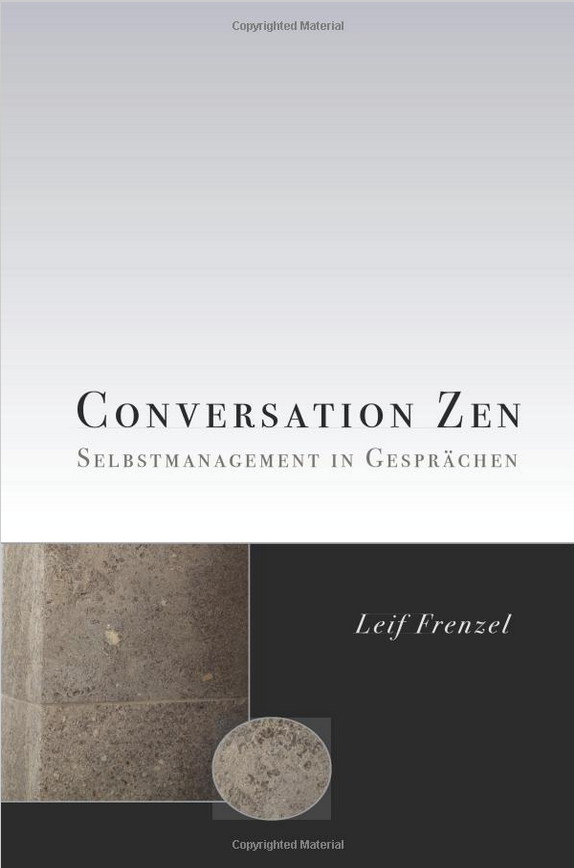 Heute möchte ich auf ein Buch hinweisen, das mit den Themen, die wir hier auf zenyourlife diskutieren, eng verwandt ist. Leif Frenzel, der Autor des Buches, hilft seinen Leser*innen dabei, sich nicht von einzelnen Aktionen eines Gesprächspartners davontragen zu lassen, sondern auch im Gespräch dem eigenen Weg folgen zu können. Wo wir hier auf zenyourlife meist über den Prozessfokus bei unserer individuellen Arbeit sprechen, der uns indirekt dabei hilft, unsere Ziele zu erreichen, thematisiert Leif Frenzel, wie man im Gespräch bei sich selbst bleiben kann, um auf diese Weise den eigenen Gesprächszielen näher kommen zu können. Das heißt: Bei beiden Aktivitäten, unserer Arbeit und unseren Gesprächen, hilft uns die Weisheit des Zen.
Heute möchte ich auf ein Buch hinweisen, das mit den Themen, die wir hier auf zenyourlife diskutieren, eng verwandt ist. Leif Frenzel, der Autor des Buches, hilft seinen Leser*innen dabei, sich nicht von einzelnen Aktionen eines Gesprächspartners davontragen zu lassen, sondern auch im Gespräch dem eigenen Weg folgen zu können. Wo wir hier auf zenyourlife meist über den Prozessfokus bei unserer individuellen Arbeit sprechen, der uns indirekt dabei hilft, unsere Ziele zu erreichen, thematisiert Leif Frenzel, wie man im Gespräch bei sich selbst bleiben kann, um auf diese Weise den eigenen Gesprächszielen näher kommen zu können. Das heißt: Bei beiden Aktivitäten, unserer Arbeit und unseren Gesprächen, hilft uns die Weisheit des Zen.
Gastbeitrag von Yvonne Förster
Conversation Zen – Die Kunst des Gesprächs
Gesprächsführung im Beruf oder zu Hause ist nicht immer leicht. Selbst wenn man eine ganz klare Idee hat, was zu Sprache kommen soll, versanden Gespräche gern im Nichts, führen zu Konfrontationen oder lassen ein ungutes Gefühl misslungener Kommunikation zurück. Das ist auch der Grund, warum wir schwierige Themen gerne vermeiden oder heikle Gespräche aufschieben. Selten lösen sich damit Probleme in Luft auf. Im Gegenteil, es wird schwieriger.
Was kann man tun, um wichtige Gespräche erfolgreich zu führen? Die gute Nachricht ist: Man braucht keine abendfüllenden Rhetorikkurse zu besuchen, um einen souveränen Umgang mit wechselnden Gesprächssituationen zu erlernen. Es gibt einige wenige Punkte, derer man sich bewusst sein sollte und Strategien, die man schnell erlernen kann, um für wichtige Gespräche gewappnet zu sein.
Warum Zen?
Um komplexe Gesprächssituationen zu meistern, kann man sich einiges aus der uralten Tradition des Zen abschauen – ohne dass man gleich bei einem alten Meister studieren muss. Stellen Sie sich vor, Sie möchten im nächsten Meeting endlich ein schon lange geplantes Projekt vorschlagen. Sie wissen, dass einige Kollegen Vorbehalte haben könnten und andere Ihnen vielleicht die Show stehlen wollen. Sie müssen also mit Einwänden, Ablenkungsversuchen und Überbietungsrhetorik rechnen. Der ältere Kollege wird wohl zu bedenken geben, das hätte man vor Jahren schon versucht und es habe nichts gebracht. Ein anderer mag sagen, dass er einen viel besseren Plan habe und noch viel besser Kontakte. Gerade als Frau darf man sich auf noch mehr Gegenwind von den Alphatieren der Firma einstellen. Da kann ein wenig alte Kampfkunst in Worte übersetzt nicht schaden.
Die Taktik
Zen bedeutet Konzentration auf das Wesentliche. Dafür muss man aber wissen, was das Wesentliche bei einem Gespräch ist. Was möchte ich erreichen? Was müssen meine Gesprächspartner verstehen? Welche Information muss klar und deutlich beim Empfänger ankommen? Das ist etwas, was man sich vor jedem Gespräch selbst klarmachen muss. Nur wer sich über das Ziel des Gesprächs im Klaren ist, kann erfolgreich kommunizieren.
Mit diesem Wissen geht man ins Gespräch. Eine solche Klarheit über das Ziel des Gesprächs führt zu größerer Selbstsicherheit und mehr Kraft, diesen Schritt in Angriff zu nehmen. Solange man selbst nicht so recht weiß, was man erreichen will, wird man wichtige oder unangenehme Gespräche auf die lange Bank schieben und sich viel mehr als nötig Gedanken und Sorgen über deren Ausgang machen.
Schritt 1:
Machen Sie sich das Ziel des Gesprächs klar. Formulieren Sie es in einem, maximal zwei Sätzen. Es sollte Ihnen deutlich vor Augen stehen. Behalten Sie es während des Gesprächs fest im Blick.
Zen bedeutet auch, in der Situation voll und ganz präsent zu sein. Dazu gehört den Raum wahr- und in Besitz zu nehmen.
Schritt 2:
Suchen Sie sich eine gute Position im Raum und in der Gruppe, aus der heraus Sie gut agieren können, alle im Blick haben und sich gut fühlen. Behalten Sie den Raum im Blick um auf Störungen schnell und bewusst reagieren zu können.
Wenn Sie ihr Ziel im Auge und die Situation soweit möglich unter Kontrolle haben, dann gilt es im eigentlichen Gespräch ihr Anliegen nicht aus dem Auge zu verlieren. Das braucht Konzentration und die Fähigkeit, Ablenkungen als solche zu erkennen. Auch wenn der Kollege versucht, Sie zu verunsichern oder der Chef abwinkt mit dem Hinweis: Hatten wir alles schon – formulieren Sie klar und eindeutig, was Ihnen an ihrem Projekt wichtig ist. Bleiben Sie bei sich und lassen Sie sich nicht auf das Überbietungsspiel oder leere Autoritätsbezeigungen ein.
Schritt 3:
Lassen Sie sich nicht von rhetorischen Ablenkungsmanövern aus dem Takt bringen. Ein gutes Selbstmanagement im Gespräch bringt sie weiter. Wie das funktioniert und was Sie selbst zum Gelingen des Gesprächs beitragen können, dazu finden Sie hier weitere Informationen. Das Buch Conversation Zen von Leif Frenzel ist kleiner aber wirksamer Leitfaden zum Selbstmanagement im Gespräch.