Zusammenfassung
Wie wird Prozessorientierung zu einem Tool, mit dem man sicher Deadlines einhalten kann? Indem man immer zuerst an der wichtigsten Aufgabe arbeitet, und zwar nur solange, wie sie noch die wichtigste ist, um das Projekt voranzubringen. Wenn man immer an dem Teilschritt arbeitet, der den größten Sprung in Richtung Erfolg verspricht, dann wird man zwangsläufig die verbleibende Zeit bis zur Deadline maximal sinnvoll nutzen.
Volltext
Ich werde öfter gefragt:
„Martin, das mit der Prozessorientierung ist ja eine super Idee, hört sich auch toll an, aber das kann ich so ja nicht umsetzen, wenn ich pünktlich zu einer Deadline fertig sein muss. Dann muss ich ja ergebnisorientiert vorgehen! Wie soll ich sonst gewährleisten, dass die Aufgabe rechtzeitig fertig wird?“
Diesem Gedankengang liegen zwei Missverständnisse zugrunde:
- Darüber, was Prozessorientierung ist
- Darüber, was die Ergebnisorientierung hier wirklich zum rechtzeitigen Fertigwerden beiträgt und was nicht
Zu Missverständnis Nr. 1:
Lustprinzip vs. Prozessorientierung
Beim ersten Kennenlernen des Konzepts Prozessorientierung stellen sich darunter viele so eine Art Laissez-faire-Stil des Arbeitens vor: Ich mache immer das, worauf ich gerade am meisten Lust habe, was mir am meisten Spaß macht. Das scheint ja auch erst einmal naheliegend, da genau diese Arbeitshaltung einen Gegenpol zum davor praktizierten Versuch darstellt, gegen sich selbst Zwang auszuüben und sich in Richtung eines Ziels anzuschieben, auch wenn die Aufgabe keinen Spaß macht. Wenn ich dann erzähle, dass man sich nicht mehr zwingen muss, dann ist die logische Folgerung, dass die neue Haltung wohl so aussehen müsse, dass man immer das tun dürfe, worauf man gerade am meisten Lust habe. Tatsächlich entspricht das ja ziemlich genau dem typischen Prokrastinationsverhalten: Ich habe eine Aufgabe vor mir, die ich als unangenehm bewerte, und dann wechsle ich zu einer Aufgabe, die mir leicht von der Hand geht – obwohl ich selbst glaube, wegen dieses Wechsels langfristig schlechter dran zu sein. Das ist die Definition von Prokrastinationsverhalten. Aber nicht die von Prozessorientierung. Prozessorientierung heißt nicht, die Aufmerksamkeit darauf zu richten, immer positive Gefühle zu haben und entsprechend nur als angenehm bewertete Aufgaben auszuwählen. Prozessorientierung heißt, die Aufmerksamkeit auf die Tätigkeit selbst zu richten – egal als wie angenehm oder unangenehm eine bestimmte Aufgabe gerade bewertet wird. Diese Aufmerksamkeitsverschiebung weg vom gewünschten Ergebnis hin zur tatsächlichen Tätigkeit hat zwar zur Folge, dass dieselbe Aufgabe ganz andere emotionale Qualitäten entfalten kann. Möglicherweise kann ich der zuvor als so unangenehm bewerteten Aufgabe ganz neue Aspekte abgewinnen, die z.B. meine Neugier wecken. Aber die Prozessorientierung selbst besteht nicht darin, sich auf die angenehmen Seiten zu konzentrieren oder nur entsprechende Aufgaben auszuwählen. Andere Gefühle sind eine (mögliche) Folge dieses Fokus auf die Ausführung einer Tätigkeit, sind aber nicht selbst Gegenstand der Aufmerksamkeit.
Das bedeutet auch: Prozessorientiert zu arbeiten und an Aufgaben zu arbeiten, die einem dem anvisierten Ziel näher bringen, ist in keinster Weise ein Widerspruch. Wir können also prozessorientiert arbeiten und trotzdem in Richtung eines Ziels voran schreiten. Damit ist die Frage geklärt, ob Prozessorientierung uns davon abhalten wird, an den für ein Ziel entscheidenden Aufgaben zu arbeiten – jetzt fehlt also nur noch eine Antwort auf die Frage, wie man nun garantieren kann, dass man mit dieser Form der Aufgabenbearbeitung auch rechtzeitig zur Deadline fertig sein wird. Davon handelt der nächste Abschnitt.
Zu Missverständnis Nr. 2:
Ergebnisorientierung, Zeitpläne und deren prinzipielle Nutzlosigkeit
Sehen wir uns zuerst einmal an, wie der übliche Umgang mit Aufgaben ist, die zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen sein müssen. Wir haben ein Ziel, das wir uns im günstigsten Falle relativ detailliert ausmalen. Diese schöne Zukunft wollen wir erreichen. Diese reichhaltige Ergebnisvision verblasst allerdings in vielen Fällen mit der Zeit. Übrig bleibt als Rumpf dieses Ziels nur noch der Appell an uns selbst: „Du musst mit dieser Aufgabe fertig werden.“ So ein Appell ist weder motivierend, da er nicht mehr enthält, was eigentlich so attraktiv an dem Ziel war, noch ist er hilfreich, da er nicht beinhaltet, wie man dieses Ziel eigentlich erreichen soll. In dieser Situation kommt uns immerhin zuhilfe, dass wir von unzähligen Produktivitätsratgebern gelernt haben, dass man ein großes, vages Ziel in handhabbare Zwischenschritte zerlegen muss. Ich mache aus einem großen, unerreichbaren Ziel viele kleine, erreichbare Zwischenziele. Und, wenn wir dem üblichen Rat folgen, versehen wir die einzelnen Zwischenziele auch noch mit einzelnen Deadlines. Dann haben wir einen Zeitplan, der enthält, was der Reihe nach wann fertig sein soll. Dieser Zeitplan suggeriert uns dann, dass wir den Prozess im Griff haben und, wenn wir uns genau daran halten, zuverlässig mit der Aufgabe fertig werden.
So ein Vorgehen ist natürlich unabdingbar, wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeitet und einzelne Teilschritte von unterschiedlichen Personen übernommen werden, die jeweils bei ihrer Aufgabenbearbeitung auf die Ergebnisse vorangegangener Teilaufgaben angewiesen sind. In diesen Fällen ist ein Zeitplan dieser Art die Minimalvoraussetzung für gelingende Zusammenarbeit. In den Fällen, in denen Prokrastination aber gnadenlos zuschlagen kann, wie z.B. einer Promotion, die man ganz allein für sich anfertigt, funktionieren diese Pläne aber nicht. Denn diese Art von Zeitplänen haben zwei grundsätzliche Probleme:
- Der Plan definiert nur (Zwischen-)Ergebnisse, keine Handlungen.
- Der Zeitbedarf neuer Aufgaben kann im Voraus nicht sinnvoll geschätzt werden.
Zum einen krankt ein solcher Plan, der „Meilensteine“ festlegt, daran, dass unklar bleibt, mit welchen Tätigkeiten diese Meilensteine eigentlich erreicht werden sollen. Bei super simplen Zielen ist das oft nicht so schlimm, weil Ergebnis und zur Erreichung des Ergebnisses notwendige Handlung intuitiv zusammen gedacht werden: Wenn ich das Ziel habe, ein sauberes Bad zu haben, ist das automatisch mit bestimmten Putzhandlungen verknüpft. Dann reicht der Eintrag „Bad“ in meiner to-Do-Liste möglicherweise aus. Trotzdem ist selbst bei so ganz simplen to-Dos die Empfehlung, auch hier ein Verb anzufügen: „Bad putzen“. Wenn ich „Bad putzen“ lese, bin ich schon einen Schritt näher an der Ausführung der Handlung, als wenn ich nur „sauberes Bad“, d.h. das dahinter stehende Ziel, lesen würde. Und genau dieser Umstand wird bei Zeitplänen im größeren Maßstab aber oft weggelassen. Da steht dann nur: „Bis Ende des Monats soll der Theorieteil meiner wissenschaftlichen Arbeit fertig sein.“ Handlungsorientiert müsste die Formulierung besser lauten: „In diesem Monat schreibe ich an meinem Theorieteil“. Die letztere Formulierung fordert sofort dazu heraus, genauer zu spezifizieren: Schreibe ich jeden Tag? Oder nur ab und an? Oder nur immer dienstags? Das liegt daran, dass ich meinen Fokus vom Ergebnis „Fertiger Theorieteil“ auf die Handlung verschoben habe. Und eine Handlung hat, im Gegensatz zu einem Ergebnis, eine zeitliche Ausdehnung. Und darum muss ich sofort, sobald ich Handlungen plane, in Dauern denken. Und das ist gut, denn es verhindert Pläne, die völlig im Land Utopia angesiedelt sind.
Zum anderen scheitert die Umsetzung aber auch bei dieser Art von Plänen, bei der immerhin sorgfältig darauf geachtet wurde, Handlungen statt Ergebnisse zu planen. Und zwar scheitern diese Pläne immer dann, wenn die Handlungen keine Routinetätigkeiten sind. Nur bei Aufgaben, die ich schon oft ausgeführt habe, ist meine Zeiteinschätzung halbwegs realistisch (wenn man noch standardmäßig einen großzügigen Puffer drauf schlägt, weil wir trotz aller Erfahrung immer den günstigsten Fall zur Planung heranziehen und wahrscheinlich auftretende Verzögerungen nicht berücksichtigen). Aber bei Aufgaben, die wir noch nie zuvor ausgeführt haben, ist jede Zeiteinschätzung völlig willkürlich. Klar können wir sagen: „Die Analyse meiner Ergebnisse sollte in einer Woche abgeschlossen sein.“ Aber was, wenn wir währenddessen auf ein Problem stoßen, das wir zuerst lösen müssen, das uns aber einen ganzen Monat Zeit kostet? Woher hätten wir von der Existenz dieses Problems wissen sollen, wo die Aufgabe doch neu für uns war? Jetzt kannst du natürlich optimistisch sagen, dass bei dir mit solchen Problemen nicht zu rechnen ist. Aber woher willst du das wissen? Fazit: Unbekannte Aufgaben haben eine unbekannte Dauer, die sich auch beim besten Willen nicht schätzen lässt. Was den Versuch, bei unbekannten Aufgaben einen Zeitplan anzufertigen, absurd macht.
Zur Veranschaulichung noch eine Metapher: Stelle dir vor, du möchtest von A nach B reisen. Du kannst nun die Straßenkarte nehmen, malst ein Kreuz bei deinem aktuellen Standort A und markierst dein Ziel B. Die direkte Verbindung zwischen A und B ist natürlich meistens nicht befahrbar, also suchst du dir eine sinnvolle Verbindungsstrecke zwischen diesen beiden Punkten und machst dich dann auf den Weg. Das funktioniert. Jetzt stelle dir vor, dass zwischen A und B überhaupt keine Straßen eingezeichnet sind. Es handelt sich um unbesiedeltes Gebiet, in dem sich noch nie jemand einen Weg gebahnt hat. Du kennst auch Flüsse und Gebirge nicht, geschweige denn kleinere Hindernisse und Geländeformationen. Nur ein großer, weißer Fleck auf der Landkarte. Wie soll das nun funktionieren? Gar nicht, die Landkarte hilft hier nicht, es ist einfach das falsche Vorgehen. Das Prinzip Zeitplan funktioniert nicht in unbekanntem Terrain. Verdammt. Was nun?
Die Antwort ist so simpel wie genial: Wenn ich durch unbekanntes Terrain wandere, dann wähle ich immer den Weg, auf dem ich gerade meinem Ziel am schnellsten näher komme. Das muss nicht immer der leichteste sein! Ich könnte z.B. den Eindruck haben, dass das schwierige Klettern über einen Berg mich dem Ziel, auf die andere Seite zu kommen, deutlich schneller näher bringen wird, als um den gesamten Gebirgszug, evtl. viele hundert Kilometer, drum herum zu wandern. Das ist aber der Weg, der erstmal anstrengender sein wird! Zurück bei der (Büro-)Arbeit gilt das gleiche: Ich wähle nicht die angenehmste Aufgabe, sondern diejenige aus, von der ich glaube, dass sie mich meinem Ziel am schnellsten näher bringen wird. Nehmen wir mal die Fertigstellung einer wissenschaftlichen Arbeit als Ziel. Dann kann ich vom Ziel her denken und überlegen, ob ich bestehen würde, wenn ich meine Arbeit genau jetzt schon abgeben würde. Falls das nicht der Fall sein sollte, stelle ich mir die Frage: Mit der Arbeit an welcher Baustelle bringe ich die Arbeit am schnellsten in Richtung Bestehen? Wenn ich z.B. vor der Frage stehe, ob ich noch die paar Quellen einarbeiten sollte, oder lieber mit dem Ergebnisteil anfangen sollte, der noch komplett blank ist – dann wird mir die oben genannte Leitfrage sehr leicht zu der Erkenntnis verhelfen, dass ich die Arbeit vermutlich auch mit ein paar weniger Quellen bestehen werde, aber ohne Ergebnisteil nie und nimmer. Also arbeite ich zuerst an der Aufgabe, die den größten Sprung in Richtung Erfolg verspricht. Das heißt aber nicht, dass ich dann den Ergebnisteil bis ins kleinste Detail fertig mache. Sondern irgendwann kommt der Punkt, an dem eine andere Baustelle meiner Arbeit einen größeren Sprung in Richtung Bestehen verspricht, dann wechsle ich zu dieser Baustelle. Auf diese Weise ist sicher gestellt, dass ich vom Wichtigen zum Unwichtigen, vom Groben zum Feinen voranschreite und keine Zeit verliere mit Details, die am Ende nicht entscheidend sind. Dieses Vorgehen garantiert, dass ich meine verbleibende Zeit optimal nutze. Und darum garantiert dieses Vorgehen am ehesten, dass ich meine Deadline einhalten werde – sofern das in meiner Macht steht, denn der Tag hat nur 24h und unvorhergesehene Probleme sind ein Fakt, der, wenn er eintritt, sich von keinem Plan der Welt ungeschehen machen lassen kann – auch wenn der Plan noch so schön war… .
Damit dieses Vorgehen klappt, muss ich eine hohe Achtsamkeit auf das haben, was ich gerade tue. Wenn ich auf das Ergebnis schiele, das ich erreichen möchte, dann fällt mir möglicherweise gar nicht auf, dass ich schon längst zur nächsten wichtigen Baustelle hätte wechseln können – weil ich an einem vorher gefassten Plan festhalte, statt auf die Dynamik meiner Prioritäten zu achten. Der Fokus auf mein Tun, Prozessorientierung, erzeugt also die notwendige Achtsamkeit, die ich brauche, um mein Handeln an meinen Prioritäten auszurichten. Und so gehen Prozessorientierung und rechtzeitiges Fertigwerden Hand in Hand.
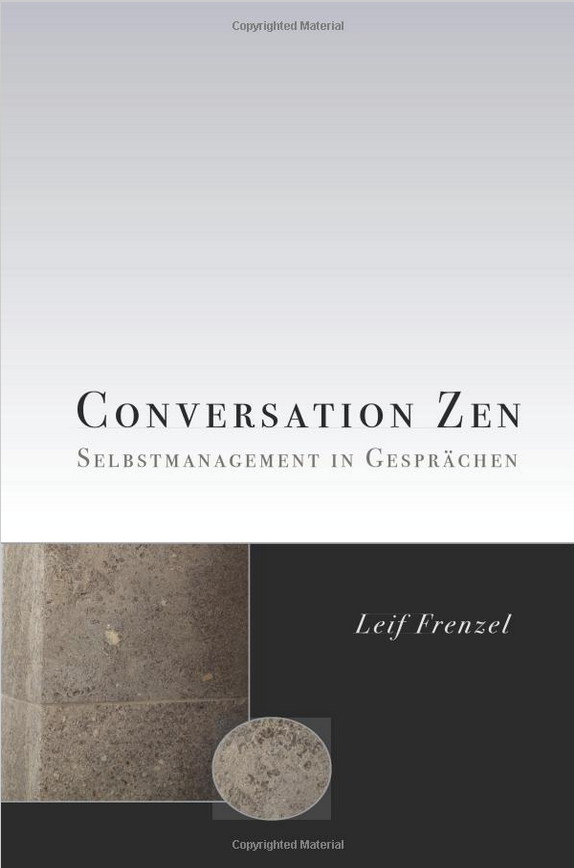 Heute möchte ich auf ein Buch hinweisen, das mit den Themen, die wir hier auf zenyourlife diskutieren, eng verwandt ist. Leif Frenzel, der Autor des Buches, hilft seinen Leser*innen dabei, sich nicht von einzelnen Aktionen eines Gesprächspartners davontragen zu lassen, sondern auch im Gespräch dem eigenen Weg folgen zu können. Wo wir hier auf zenyourlife meist über den Prozessfokus bei unserer individuellen Arbeit sprechen, der uns indirekt dabei hilft, unsere Ziele zu erreichen, thematisiert Leif Frenzel, wie man im Gespräch bei sich selbst bleiben kann, um auf diese Weise den eigenen Gesprächszielen näher kommen zu können. Das heißt: Bei beiden Aktivitäten, unserer Arbeit und unseren Gesprächen, hilft uns die Weisheit des Zen.
Heute möchte ich auf ein Buch hinweisen, das mit den Themen, die wir hier auf zenyourlife diskutieren, eng verwandt ist. Leif Frenzel, der Autor des Buches, hilft seinen Leser*innen dabei, sich nicht von einzelnen Aktionen eines Gesprächspartners davontragen zu lassen, sondern auch im Gespräch dem eigenen Weg folgen zu können. Wo wir hier auf zenyourlife meist über den Prozessfokus bei unserer individuellen Arbeit sprechen, der uns indirekt dabei hilft, unsere Ziele zu erreichen, thematisiert Leif Frenzel, wie man im Gespräch bei sich selbst bleiben kann, um auf diese Weise den eigenen Gesprächszielen näher kommen zu können. Das heißt: Bei beiden Aktivitäten, unserer Arbeit und unseren Gesprächen, hilft uns die Weisheit des Zen.